 Inklusivität, Diversität und Repräsentation sind bekanntermaßen links-faschistische Kampfbegriffe, mit denen die Social Justice Warriors seit Jahrzehnten versuchen, die Gesellschaft zu spalten. Jetzt bemühen sie sich auch, das Pen & Paper Rollenspiel kaputt zu machen. Der Molotov-Cocktail, den sie dafür verwenden, kam 2019 in Buchform heraus und heißt Roll Inclusive.
Inklusivität, Diversität und Repräsentation sind bekanntermaßen links-faschistische Kampfbegriffe, mit denen die Social Justice Warriors seit Jahrzehnten versuchen, die Gesellschaft zu spalten. Jetzt bemühen sie sich auch, das Pen & Paper Rollenspiel kaputt zu machen. Der Molotov-Cocktail, den sie dafür verwenden, kam 2019 in Buchform heraus und heißt Roll Inclusive.
Hi, liebe Lesenden, ihr seid hoffentlich noch nicht weggelaufen? Hier ist Florian, euer linksversiffter Blogautor. Ich muss gestehen: Mir sind nur ganz dröge und trockene Einstiege für diesen Artikel eingefallen, bis ich auf die Idee kam, ihn aus der Arschloch-Perspektive zu schreiben. Leider gibt es diese Perspektive wirklich, und sie richtet echten Schaden an, daher möchte ich mich jetzt ausdrücklich von meinem ersten Absatz distanzieren.
Damit ich nicht nochmal in diese Verlegenheit komme, habe ich für dieses Thema einen Gast-Autoren eingeladen, der mit mir zusammen Roll Inclusive rezensiert, und mir hoffentlich ein wenig auf die Finger haut.
Markus: Ich hol schon mal das Aventurische Lexikon, das hat genug Wumms!
Florian: Okay, okay, ich werde mich benehmen.
Ich freue mich auf jeden Fall wie ein Honigkuchenpferd darüber, dich im Rollenspielblog begrüßen zu dürfen!
Markus: Und ich freue mich mega über die Gelegenheit, an dem Projekt mitzuarbeiten!
Los geht’s:
Roll Inclusive – Hintergrund
Roll Inclusive ist in eine Anthologie, die in Rekordzeit und trotz widriger Umstände erschienen ist: Erdacht im Sommer 2018, veröffentlicht im Herbst 2019, dank Crowdfunding und trotz zwischenzeitlicher Insolvenz des Verlags. Hut ab dafür erstmal!
Herausgegeben wurde das Buch von Aşkın-Hayat Doğan, Frank Reiss und Judith Vogt.
Vorwort
Aufbau und Gliederung
Im Vorwort von Roll Inclusive werden dessen Werdegang, Aufbau und Zielsetzung sehr offen beschrieben.
Gegliedert ist Roll Inclusive in kurze Essays unterschiedlicher Autor*Innen, soll aber grob in drei Bereiche einteilbar sein.
- Der erste beschäftigt sich mit den theoretischen Hintergründen und Grundlagen,
- der zweite beschäftigt sich mit spezifischen Perspektiven und Herausforderungen,
- der dritte beschäftigt sich mit Rollenspielpraxis und Umsetzung.
Diese Dreiteilung ist beim Lesen weder Markus noch Florian aufgefallen, eher empfanden wir es als fließenden Übergang. Zwar beschäftigen sich einige der ersten Texte mehr mit grundsätzlichen Dingen, halten sich daran aber nicht stur. Schon in den ersten Artikeln werden spezielle Gruppen in den Fokus genommen oder es gibt Überlegungen zur praktischen Umsetzung. Das zieht sich dann durch die Artikel, bis gegen Ende ein reiner Fokus auf die Praxis gelegt wird. Hier fühlt man sich als Rollenspieler*in dann gleich zu Hause, denn es gibt jede Menge Tabellen mit Nano-Games und Bullshit-Bingos. (Letztere liegen dem Buch übrigens auch als Postkarten bei. Zusätzlich gibt es ein Lesezeichen, für das vor allem Florian sehr dankbar war.)
Zielgruppe

Die Zielgruppe des Buches ist ein kniffliges Thema. Laut Vorwort richtet es sich nicht ausschließlich an Rollenspieler*innen. Das ist schonmal schön, aber darüber hinaus gäbe es viele verschiedene Gruppen, an die sich das Buch richten könnte:
- Menschen, die Florians furchtbaren ersten Absatz unterschreiben würden, und die man erst davon überzeugen müsste, dass Diversität im Rollenspiel (und überhaupt) etwas Gutes ist.
- Menschen, die bereits überzeugt sind, dass Diversität wünschenswert ist. Diese lassen sich wiederum in zwei Gruppen unterteilen:
- Menschen, die sich abseits des Rollenspiels mit dem Thema beschäftigt haben, und die sich mit den Theorien und der Fachsprache bereits auskennen.
- Menschen, denen die wissenschaftliche Fachwelt bisher verschlossen geblieben ist, und die dafür offen sind, etwas Neues zu lernen und bereichert zu werden.
Gruppe 1 würde vermutlich nicht die 22,95 € für dieses Buch ausgeben. Diese Gruppe einfangen zu wollen, würde Gefahr laufen, die Zeit der anderen beiden Gruppen zu verschwenden. Daher wäre es wünschenswert, wenn 2. a) und b) die Adressat*Innen wären.
Ob das gelingt, werden wir – hoffentlich – im Auge behalten. Allerdings sei zur Transparenz darauf hingewiesen, dass wir uns zu Gruppe 2. a) zählen und über die Zugänglichkeit für 2. b) nur fremdurteilen können. Auf jeden Fall kommen wir zu den Zielgruppen in unserem Fazit zurück.
Es gibt übrigens noch andere Möglichkeiten, die Zielgruppen zu ordnen: Innerhalb der Gruppe derer, die Rollenspiel schon kennen, gibt es zum Beispiel:
- Private Spielgruppen
- Öffentliche Spielgruppen (=Actual Plays)
- Verlage (z.B. Ulisses), die die Welt erschaffen und Vorgaben machen
- Rollenspiel-Autor*Innen (z.B. Markus) oder Illustrator*Innen, die die Welt ausschmücken
Auch hier ist interessant, an wen sich das Buch richtet. Wir werden hierauf zurückkommen, laden aber auch dich dazu ein, dies mitzuverfolgen.
Unsere Rezension
Aufbau und Gliederung
Kritisieren, auseinandersetzen und zweifeln – dazu wird noch im Vorwort von Roll Inclusive ausdrücklich aufgerufen. Das Buch will also keine Bibel sein, die das letzte Wort diktiert, sondern Prozesse in Gang setzen. Wir fühlen uns dadurch ermuntert, mit unserer Rezension ein wenig mehr richtig ausführlich ins Detail zu gehen. Deshalb gibt es nicht nur einen Blog-Artikel, sondern gleich zwei:
- Die Essays in Roll Inclusive sind recht vielfältig und haben es verdient, von uns einzeln unter die Lupe genommen zu werden. Wir besprechen das Buch also Essay für Essay. Dafür geben wir immer zuerst eine kleine Zusammenfassung. Anschließend schildern je Markus und Florian ihre persönlichen Gedanken dazu. Das passiert noch in diesem Artikel.
- Das Fazit zu unserem Review findest du nicht hier, sondern in einem zweiten, abschließenden Artikel. Du weißt ja: Endgegner*innen und Schätze kommen immer am Ende des Abenteuers.
Unsere Zielgruppe
Diese Rezension ist für dich, wenn du dich in einer dieser Aussagen widerfindest:
- Du denkst darüber nach, Roll Inclusive zu lesen und möchtest erstmal mehr darüber wissen
- Du hast Roll Inclusive gelesen und möchtest wissen, was andere darüber denken
- Du hast nicht vor, Roll Inclusive zu lesen, möchtest aber trotzdem wissen, worum es da geht
Achso, natürlich könntest du dich auch darin wiederfinden:
- Du hast Roll Inclusive geschrieben und freust dich über Feedback oder Diskussionsbeiträge
Auch bei unseren Zielgruppen gilt: Ob dieses Versprechen, eingehalten wird, kannst du gerne selbst versuchen mitzuverfolgen. Wir freuen uns über einen Kommentar, ob wir das geschafft haben.
Unser Anspruch
Roll Inclusive greift ein aus unserer Sicht enorm wichtiges Themenfeld auf. So viel spoilern wir schonmal unser Fazit vorweg: Das tut es in durchaus gelungener Weise. Auf jeden Fall hat es uns deutlich zum Nachdenken angeregt. Und so bitten wir auch, gelesen zu werden: Wir denken kritisch über die Essays nach, aber immer ausgehend von einer Position des Wohlwollens.
Uns ist klar: Unsere Texte geben lediglich unsere individuellen Wahrnehmungen und Sichtweisen wieder. Wir erheben keinen Anspruch auf Objektivität, höchstens auf starke Argumente. Vor allem möchten auch wir so verstanden werden, dass wir hier Diskussionsbeiträge leisten, die den Diskurs ankurbeln und nicht beenden sollen. In diesem Sinne rufen auch wir zu Kritik an uns selbst auf. Bestimmt treffen wir nicht immer ins Schwarze. Korrigiere uns gerne, wo wir fehlgehen, oder weise uns auf Betriebsblindheit oder Fettnäpfchen hin.
Roll Inclusive – TEIL 1
Frank Reiss: Wofür wir eine bessere Repräsentation von Vielfalt im Pen & Paper-Rollenspiel brauchen
Der erste Essay bietet vor allem Begriffsklärungen (Diversity, Marginalisierung, Repräsentation, etc.). Ziel ist es, eine gemeinsame Argumentationsbasis zu schaffen. Danach wird der reflexive Prozess erläutert, dass jede Darstellung in Rollenspielwelten aus einer (Welt-)Sicht erfolgt, aber in der anderen Richtung auch die Art bestimmt, wie wir Dinge sehen.
Nach einem Exkurs zum Thema Macht werden die Kernpunkte von Darstellungen, ihre zugrundeliegenden Faktoren sowie unbewusst ablaufende Prozesse besprochen.
Markus:
Der Text bietet einen schönen Einstieg ins Thema. Beim ersten Lesen hätte ich mir ein wenig mehr Schärfe gewünscht, aber rückblickend ist das nicht nötig, da die folgenden Artikel viele Punkte näher beleuchten. Der Ton des Aufsatzes ist erfrischenderweise kein bisschen leidend oder anklagend, sondern eher fröhlich gehalten, was deutlich Lust aufs Weiterlesen macht.
Gefehlt hat mir lediglich beim Thema Normalisierung von Diversität ein Hinweis auf das (alte) DSA. Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich in diesem System sehr zu Hause bin und dementsprechend hierzu mehr sagen kann und möchte. Außerdem verweisen natürlich auch mehrere folgende Artikel auf dieses System, das in Deutschland noch immer zu den am weitesten verbreiteten zählt.
Zum Thema: Gerade in den älteren DSA Publikationen nahm ich immer eine starke Diversität wahr: Frauen waren, außer bei den Novadi und in Andergast gleichberechtigt, Aranien wurde de facto von Frauen regiert. Die meisten Professionen waren geschlechtsunabhängig und selbst wichtige NSCs konnten queer sein (z.B. Thesia von Ilmenstein oder Nahema).
Florian:
Erinnert sich noch jemand an meinen Arschloch-Einstieg in diesen Blog-Artikel? Frank Reiss geht wesentlich sachter mit seinen Leser*Innen um. Wie es sich für einen guten Einstieg gehört, tritt er hier noch niemandem auf die Füße, sondern lädt ein, sich wohl zu fühlen.
Was bei mir aus diesem Artikel besonders hängen geblieben ist, ist folgender Satz:
Abhilfe gegen das ständige Reproduzieren von Stereotypen gibt es leider nicht ohne Aufwand.
S. 20
Hier wird der Grundstein gelegt für eine in meinen Augen sehr wichtige Erkenntnis: Repräsentation und Diversität sind Arbeit. Das ist anstrengend. Das ist nichts, was man mal eben so macht. Ich finde es wichtig, das herauszustellen und sich keine Illusionen darüber zu machen, man könne das ohne Mühe erreichen. Spoiler: Darüber werde ich noch mehrfach stolpern.
Giulia Pellegrino: Sein als ob – Aneignung und Aushandlung von Identität im Rollenspiel
Wie versetzt man sich in eine fremde Rolle hinein? Diesem Prozess, dieser Mechanik wird in diesem Essay nachgegangen. Auch er bietet zum einen Einstieg ein eigenes Glossar. Der zentrale Begriff darin ist der des „Dämons“. Wenn wir das richtig verstehen, hat die Autor*in selbst diesen Begriff definiert. Gemeint sind unbewusste Denk-Muster, die unwillkürliche Reaktionen hervorrufen.
Der Essay beinhaltet auch einen Exkurs zu neuronalen Prozessen und Spiegelneuronen im Hinblick auf die Entwicklung von Klischees und Stereotypen.
Markus:
Insgesamt suche ich hier noch den klaren Fokus. Schon der Schreibstil schwankt zwischen wissenschaftlicher Betrachtung und eher literarischen Fantasyanklängen. Die vielen Fakten scheinen aus einem größeren Themenfeld komprimiert, während der Überschlag zum eigentlichen Thema des Buches am Ende fast hinterhergeschoben wirkt.
Kein Zweifel, die Autorin verfügt über großes Wissen und wüsste sicher noch viel mehr Interessantes zu erzählen, allerdings ist der Platz bei einem Essay immer begrenzt. Die Einführung des Begriffes „Dämonen“ weckt sicher das Interesse von Fantasyfans, bedarf aber einer sehr langen Erklärung, wodurch Raum für andere Punkte verloren geht. Trotzdem hat mir hier ein Bezug auf den Begriff Daimon bei Sokrates gefehlt. Möglicherweise wäre in diesem Aufsatz einfach ein Wort wie „Automatismen“ oder „Routinen“ verwendbarer. Das wäre vielleicht weniger charmant gewesen, hätte den Artikel für mich aber deutlich klarer gemacht.
Ohnehin finde ich die Verweise auf naturwissenschaftliche Aspekte eine gute Bereicherung des Buches. Sie könnten jedoch bei einigen auch das Postulat von Objektivität und unwiderlegbarer Wahrheit erwecken. Beim Thema der Spiegelneuronen wurde leider nicht der aktuelle Forschungsstand berücksichtigt, welcher das Thema deutlich relativieren würde.
Florian:
Ich schließe mich Markus‘ Kritik des Begriffs „Dämon“ an. Ich glaube, er lädt eher zu Missverständnissen ein als zu Klarheit.
Außerdem stolperte ich der Lektüre über folgendes: Auf S. 32 heißt es, die in diesem Essay dargelegten Aspekte könnten „für die in dieser Essay-Anthologie verhandelten Themen nutzbar gemacht werden“.
Da habe ich mich sofort gefragt: Werden sie denn auch genutzt? Oder werden hier Grundsteine gelegt, auf die später nicht aufgebaut wird?
Jetzt, wo ich das Buch in seiner Gesamtheit kenne, kann ich sagen: Nö. Taucht nicht mehr auf. Auch der Dämon kommt nicht mehr vor.
Guddy Hoffmann-Schoenborn: Das Spiel mit eingefahrenen Rollenbildern – Ganz schön hässlich?
Dieser Essay holt die Leser*Innen beim allseits bekannten Prozess der Charaktererschaffung ab. Mit diesem wird die Bedeutung von Geschlechterdiversität illustriert.
Der Artikel stellt positive Ansätze dar, wie die Durchbrechung tradierter Klischees in diversen Rollenspielsystemen funktioniert. Es wird geschildert, wie die rein binäre Sicht zweier gegensätzlicher Pole aufgebrochen werden kann, zugunsten einer abwechslungsreicheren Bandbreite.
Bei der Betrachtung des Themas „Schönheit“ wird deren scheinbar ewiger und allgemeingültiger Charakter in Frage gestellt, wodurch auch hier zum einen neue Möglichkeiten eröffnet, zum anderen aber auch ungewollte Verletzungen vermieden werden. Gleiches gilt für das Thema Körperform.
Markus:
HIGHLIGHT!
Insgesamt schildert der Text gut, welchen Wert das Aufbrechen von Stereotypen bieten kann, gibt jedoch keine Erklärung, warum diese überhaupt vorhanden sind, bzw. warum viele sich mit ihnen so wohlfühlen. Aber keine Sorge, das holen einige der folgenden Artikel nach. So bleibt hier noch die Spannung erhalten. Trotzdem sagt die Autorin, dass innerhalb einer Rollenspielgruppe in Abstimmung auch Stereotypen ok sind, wichtig ist nur, dass sich niemand verletzt fühlt.
Nahema wird hier als Beispiel für eine typische femme fatale herangezogen, dabei ist sie aus meiner Sicht eines der frühen Beispiele für einen genderfluiden Charakter: In einigen ihrer Tarnidentitäten tritt sie als Mann oder mit männlichen Zügen auf. Sie hat außerdem romantische Beziehungen mit unterschiedlichen Geschlechtern.
Von der Schreibweise hat mir dieser Text mit am besten gefallen. Er zeigt einen sehr unterhaltsamen Ton, ohne dabei an Ernsthaftigkeit und gut strukturierter Aussage zu verlieren. Auf angenehme Weise versucht er die Lesenden zur Selbstschau und zum Wagnis neuer Wege zu inspirieren.
Florian:
Mein Highlight-Essay kommt erst noch.
Dieser Essay läuft in meinen Augen Gefahr, Klischees ausschließlich schlecht zu reden, sodass man den Schluss daraus ziehen könnte, man sollte immer vielschichtige Charaktere verwenden, die man nicht auf den ersten Blick einordnen kann. Das steht aber einer alten Spielleiter*innenweisheit gegenüber: Manchmal tun Klischees dem Rollenspiel gut – vor allem bei nicht zentralen NSCs. Klischees helfen nämlich, gemeinsamen Boden im Vorstellungsraum zu schaffen, ohne viele Worte verlieren zu müssen. Hierüber muss ich aber in einem eigenen Artikel schwadronieren.
Beim Lesen des Essays stellte ich mir außerdem zunehmen die Frage: Was ist der Punkt des Ganzen? Worauf läuft das hinaus? Ich glaube, es geht hauptsächlich um „Sensibilisierung“. Also darum, das Problemfeld offenzulegen. Das ist von Natur aus nicht unbedingt konstruktiv. Aber gerade für den Beginn des Buches völlig in Ordnung.
Was bei mir hier vor allem hängen blieb, ist folgendes coole Zitat. Der Kontext ist der, auf den Markus schon anspielte: Es kann auch Spaß machen, in einer Spielrunde nur Stereotypen zu spielen. Man solle dabei nur aufpassen, in welche Richtung der Spaß geht, also über wen man sich dabei lustig macht:
Parodien funktionieren dann am besten, wenn man nach oben austeilt und nicht nach unten.
S. 60
Stimmt.
Lena Falkenhagen: Nur einen Würfelwurf voneinander entfernt – Die politische Dimension des Rollenspiels
Auch Rollenspiel kann nie frei sein kann von politischer Dimension. Mit dieser These beginnt Lena Falkenhagens Essay.
Rollenspiel sei politisch, weil immer auch Themen des politischen Diskurses betroffen sind, außerdem haben auch Rollenspielwelten politische Systeme. Ein Beispiel hierfür sei die Darstellung des Tschetschenien-Konflikts in „Vampire – Die Maskerade“. Aber auch das Thema Sex(ualisierte) Gewalt im Rollenspiel wird angeschnitten. Dabei geht es jedoch nicht um das Postulat ständiger political correctness. Das bewusste Übertreten kann in Rollenspielrunden möglich und mitunter sogar erfahrungsreich sein, solange alle Spieler*innen einverstanden sind.
Dieser Text erklärt als erster die positive Wirkung von Klischees und Stereotypen und beantwortet damit die Frage, warum wir so oft zu ihnen greifen. Laut der Autorin muss es also nicht immer um das Bekämpfen oder Verurteilen gehen, manchmal kann auch Refraiming von Konflikten eine gute Idee sein. Der Vorteil von bewusstem politischen Rollenspiel liege in der intensiven persönlichen Erfahrung und damit in der Erweiterung des eigenen Horizonts.
Markus:
Damit spricht die Autorin einen Punkt an, dem ich mich gut anschließen kann. Ohnehin fühlte ich mich bei ihrem Essay sehr gut abgeholt und mitgenommen. Ihr Zug war so stark, dass ich keinerlei Haltestellen zur Kritik gefunden habe. War auch nicht nötig, denn am Zielpunkt fühlte ich mich sehr wohl und um einige neue Ansätze und Perspektiven bereichert.
Eine Frage hat sich bei mir aber noch zum Spielen von Stereotypen entwickelt: Könnte es vielleicht interessant sein, zu erheben, wie viele Rollenspieler*innen im Reallife eher marginale Charaktere sind? Je nach Zahl könnte man überlegen, ob es für diese auch eine wohltuende Erfahrung sein, im Spiel mal einen Charakter in der Mitte der Gesellschaft zu spielen.
Florian:
Vielleicht muss ich doch keinen eigenen Beitrag zum Thema NSCs und Klischees schreiben. Auch sonst schließe ich mich Markus an: Der Artikel war zu rund, als dass ich mich irgendwo hätte stoßen können.
Roll Inclusive – TEIL 2
Mike Krzywik-Groß, Kritischer Treffer? Kritisches Weißsein! – Rassismuskritisches Denken und Handeln im Rollenspiel
Rassismus im Rollenspiel ist das Thema dieses Essays. Das R-Wort habe die „Subtilität eines Feuerballs“ schreibt der Autor, und erhitze „die Gemüter in gleicher Weise, wie es verbrannte Erde hinterlässt“. Wenn man in diesem Bild bleibt, ist es fair, zu sagen: Der Tonfall, in dem der Essay geschrieben ist, kommt nicht gerade Löscharbeiten gleich, sondern feuert weiter an. Er ist direkt und offensiv.
Der Essay beginnt mit einem Exkurs über die Frage, weshalb es ok ist, dass ein Text über Rassismus von einem Weißen geschrieben wird. Anschließend wird der Begriff Rassismus erläutert. Die wichtigsten beiden Punkte dieser Definition sind:
- Intention ist für Rassismus irrelevant. Das heißt unter Anderem: „Ich hab’s nicht so gemeint“ spielt dabei keine Rolle.
- Rassismus ist ein Resultat und Wirkmechanismus des Kolonialismus
Begrüßenswert findet der Autor, dass in Rollenspielen ein Trend bei der Charaktererstellung erkennbar ist: Zunehmend verschwindet der Punkt „Rasse“. Er schränkt aber ein, dass das reine Ausklammern phänotypischer Unterschiede das Problem nicht verschwinden lässt. Es lässt den vorhandenen Stereotypen in den Köpfen freien Lauf. Rollenspielwelten sieht er als Allegorie und gleichzeitig als Spiegel realer Gesellschaften, die neue Möglichkeiten der Auseinandersetzung bieten.
Nach einigen weiteren Ausführungen über Schuld und Privilegiertheit der Weißen bietet der Autor zum Abschluss eine Checklist mit „Tipps für einen rassismuskritischen Spieltisch“. Diese sind – passend zum Tonfall des Essays – in Imperativform gehalten. Zum Beispiel:
- Übernimm Verantwortung für dein Weißsein
- Höre People of Color zu
- Bau doch in den nächsten Tavernenbesuch eine Schwarze Wirtin ein
Markus:
Meiner Kritik vorwegnehmend: Ich habe selbst Migrationshintergrund, genügend, um von Deutschen als „Ausländer“ wahrgenommen zu werden, manchmal aber zu wenig, um von PoC auf ihrer Seite akzeptiert zu werden. Die nachteiligen Erfahrungen, die Aşkın-Hayat Doğan im folgenden Aufsatz beschreibt (z.B. Polizeikontrollen), kann ich jedoch alle aus meinem persönlichen Erlebnisschatz bestätigen. Insofern denke ich, dass meine Kritik aus einem vergleichbaren Blickwinkel kommt.
Die von Mike Krzywik-Groß getroffene Unterscheidung von Antirassismus und Rassismuskritik ist sehr diffizil und nicht immer ganz nachzuvollziehen. Dem Rassismus „Alternativen entgegenzusetzen“ formt eigentlich einen Anti (lat.: gegen) Rassismus, den er aber deutlich ablehnt. Gemeint ist vielleicht eher ein stufenweiser innerer Wandel, ohne dass die Betreffenden gleich für sich eine Rassismusfreiheit postulieren könnten. Seiner Schilderung nach sind weiße Menschen immer privilegiert. Das mag global gesehen richtig sein, allerdings wird hier sehr verallgemeinert: Was ist mit Migrationshintergrund? Wann gelte ich als weiß? Ich persönlich habe das Problem mit Polizeikontrollen ebenfalls. Hier wäre zumindest mal der Hinweis auf intersektionale Diskriminierung angebracht?
Leider fehlt auch völlig die Thematisierung, dass BIPoC keine homogene Gruppe darstellen, sondern aus verschiedenen Gruppen bestehen, die durchaus auch untereinander rassistisch sein können. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um eine Täter-Opfer Umkehr, das Verhältnis ist wohl eindeutig, sondern um eine differenzierte Betrachtung. Sehr häufig liefert der Text anklagende Schulddarstellungen und zeichnet sich durch die Verben „sollen“ und „müssen“ aus.
In seiner Energie verliert der Text außerdem manchmal seine logische Konsequenz. Zunächst werden ökonomische Punkte als Basis von Rassismus geschildert. Beim Thema Geflüchtete scheinen sie diesen plötzlich zu übersteigen (S. 96), wenn es darum geht, dass bestimmte Geflüchtete eher aufgenommen werden als andere.
Mit der Nutzung der Formulierung „wir Weißen“ wirkt es so als beziehe der Autor die Lesenden klar in seine Gruppe mit ein, was zum einen aus den o.g. Gründen zum Migrationshintergrund nicht gerechtfertigt ist, zum anderen beinahe zu implizieren scheint, dass BIPoC das Buch nicht lesen. Und da haben wir wieder die Ausgrenzung. Bevor Ihr Lesenden aber jetzt meine Kritik auseinandernehmt, lest schnell noch den Kommentar zum nächsten Essay, denn diese beiden sollte man besser als zwei Teile einer Einheit betrachten.
Florian:
Ich bin ein Weißbrot ohne jeden Migrationshintergrund. Ich bin daher die Zielgruppe dieses Essays. Dass der Essay eine solche Zielgruppe hat, wundert mich. Dadurch unterscheidet er sich nämlich von allen anderen Essays. Besonders deutlich fällt mir auf, dass der Autor zwar erläutert, warum er als Weißer sich zu diesem Thema äußern darf, gleichzeitig stellt er nie wirklich klar, warum er sich dabei nur an Weiße richtet. Dass er das explizit tut, wird übrigens in der ersten Fußnote klar:
Unter «wir» verstehe ich im Rahmen dieses Essays weiße Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft.
S. 98
Definitionen in Fußnoten… puh… Ich hab viel zu den Fußnoten dieses Bandes zu sagen. Aber das gehört nicht hier her; das mache ich im Fazit-Artikel. Zurück zum Punkt: Hier wird erklärt, dass das Wort so genutzt wird, aber nicht warum. Das wundert mich und hat für mich den Einstieg in den Essay etwas verhunzt. Das war für mich aber der einzige Stolperstein.
Anders als Markus hat mich der Artikel richtig identifiziert und angesprochen. Der Stil ist offensiv und spart nicht an Imperativen. Das fand ich aber ganz erfrischend zu lesen und hat mich nicht gestört. Auch inhaltlich sind mir keine Inkonsistenzen aufgefallen. Ich hab mir fast zu wenig auf die Füße getreten gefühlt.
Der einzige Punkt, der mir noch negativ aufgefallen ist, hat nur randständig etwas mit dem Thema zu tun. Ich meine den Appell, man solle eine Schwarze Wirtin ins Spiel einbauen. Das schlägt wieder in die Kerbe “NSCs und Klischees”, und ich habe das Gefühl, dass hier wieder Rückschritte gemacht wurden, zurück zum Stand von vor Lena Falkenhagens Essay. Offenbar muss ich also doch diesen Artikel schreiben…
Aşkın-Hayat Doğan: People of Colour zwischen Othering und adäquater Repräsentation
Dieser Essay eröffnet den Blick eines Mannes of Color auf das Rollenspiel. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Aventurien und der Frage, wie attraktiv die Tulamidenlande oder Novadis für PoC sind. (Spoiler: Nicht sehr.)
Markus:
Ich habe es lange versucht, auch in diesem Artikel die inhaltliche Zusammenfassung von meiner Stellungnahme zu trennen, aber es gelingt mir nicht. Zu so vielen Punkten möchte ich Anmerkungen machen, dass eine Trennung unübersichtlich würde. Also Vorsicht: im Folgenden gibt es Zusammenfassung und meine Position.
Auch dieser Text beginnt mit Begriffsdefinitionen, allerdings ohne klarzustellen, ab wann ich weiß, bzw. PoC bin. Diese rein binäre Aufstellung finde ich etwas zu kurz gegriffen, da es hier in beiden Richtungen Übergangsbereiche gibt. Der Autor zählt sich zur zweiten Gruppe. Ich vermute, dann darf ich das auch.
Als Einleitung zum eigentlichen Problem schildert der Autor dann seine Unzufriedenheit über die orientalisierende Kulturen bei DSA. Die dort als exotisch geschilderten Namen sind für den Autor gebräuchlich und in jeder der möglichen Gruppen fand er auch einen Aspekt, dem er sich nicht zuordnen wollte: Misogynie bei den Novadi, Sklavenhaltung bei den Tulamiden.
Auch wenn es sich um das persönliche Erleben des Autors handelt, finde ich die Darstellungsweise schwierig. Misogyn sind beispielsweise auch Andergaster (weiß) und Sklaverei ist besonders in Al’Anfa verbreitet, wobei das System der Leibeigenschaft im Mittelreich und vor allem im Bornland nicht wirklich besser ist.
Gerade ältere Rollenspielsysteme orientieren sich in der Darstellung kultureller Gruppen oft an historischen Vorbildern unserer Welt und da gehörten derartige Systeme der Ungerechtigkeit leider dazu. Das heißt nicht, dass man sie unüberlegt reproduzieren sollte, aber schon, dass man bei allen Kulturen den gleichen Maßstab anlegen sollte.
Vergessen wird hier Aranien, auch eine Tulamidische Kultur, die de facto ein Matriarchat darstellt, aus meiner Sicht für die Entstehungszeit schon ein cooler Ansatz. Außerdem beinhaltet DSA immer das optionale Element: Niemand würde sich an einem Tulamiden stören, der gegen Sklaverei ist. Als Hinweis sei noch erwähnt, dass Sklaven in Aventurien nicht selten auch Weiße sind, insbesondere Thorwaler, die selbst gegen die Sklaverei kämpfen.
Anschließend schildert der Autor Beispiele aus Spielgruppen, die keine Characters of Color wollen und merkt an, dass bildliche Darstellungen von PoC äußerst selten und oft klischeebelastet sind.
Beide Punkte finde ich traurig, doch habe ich mich gefragt, aus welchem Jahr/Setting diese Beispiele kommen und wie repräsentativ sie für die gesamte Szene gesehen werden können. Handelt es sich um eine Mehrheit, um einen Trend oder um bedauerliche Einzelfälle in Gegenwart oder Vergangenheit?
Um den generellen Umgang mit PoC innerhalb der Community wiederzugeben, beschreibt Doğan das Scheitern eines Rollenspiels über schwarze Sklavinnen. Hier wird bei der Beschreibung des fehlenden Erfolgs dieses Systems nicht angegeben, ob es wirklich an der Hautfarbe der Charaktere liegt, an deren Geschlecht, am gesamten Setting oder schlicht am Spielsystem. Mich hätte interessiert, ob Feedbacks aus der Community erhoben wurden.
Danach gibt der Autor seine Hinweise, wie es besser gehen könnte. Aus meiner Sicht ist hier viel Interessantes dabei. Ältere RPGs haben sich bei der Weltenerschaffung leider wie oben gesagt oft an Klischeevorstellungen der irdischen Historie bedient, wodurch z.T. auch kolonialistische Züge wieder aufgegriffen werden.
Schwierig finde ich den Punkt der „kulturellen Aneignung“ – ähnlich wie B. Maier es in seinem späteren Aufsatz darstellt. Doğan geht nicht auf die teilweise recht unterschiedlichen Positionen zu diesem Begriff in den Kulturwissenschaften ein, sondern bleibt bei einer recht einseitigen Verurteilung. Sollte kulturelle Aneignung in RPGs konsequent vermieden werden, dürfte keine RPG-Kultur irgendwelche Elemente einer anderen Kultur haben. Selbst eine Weidener Ritterrüstung ist eine kulturelle Aneignung und aus historisch-archäologischer Sicht meist ein romantisierendes Klischee. Und natürlich entspricht Weiden nicht dem irdischen Mittelalter, dem diese Rüstungsform entstammt. Wie in den anderen Aufsätzen zur Wirkung von Stereotypen und Klischees insgesamt festgehalten, bleibt fraglich, ob RPG-Kulturen, die völlig ohne Bezug zum Irdischen sind, von Spielenden dann noch so aufgenommen werden können, dass tiefe Immersion möglich ist.
Der Autor wiederholt auch den Hinweis einer anderen Autorin: Wenn ihr PoC Charaktere spielt, spielt sie wie eure Kultur, nur in anderem Setting. Wenn ich ein pakistanisches Mädchen in einem dafür geschaffenen RPG spiele (My sister Malala), frage ich mich nach dem Sinn des Settings, wenn ich eigentlich eine Kroatin oder eine Deutsche spiele. Man darf sich hier fragen, ob bei dieser Weise nicht eigentlich die Punkte kulturelle Aneignung und Othering komplett anschlagen. Sehr begrüßt habe ich hingegen die Punkte zum System „Harlem Unbound“, welches den Spielenden detaillierte Hinweise gibt, um einen stimmigen Charakter im Setting spielen und sich so in diese andere Welt und eine andere Perspektive einfühlen zu können.
Der Autor betont selbst, dass in diesem Text keine allgemein gültige Position formuliert werden soll, sondern dass es sich lediglich um seine persönliche Meinung handelt. Dennoch erscheinen mir selbst innerhalb dieser Meinung einige Punkte kontrovers. In der Zusammenschau mit dem Artikel zuvor zeigt das mir, wie wichtig dieses Thema ist, nicht nur für das Rollenspiel, sondern für den gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Von einer Lösung sind wir in diesem Bereich sicherlich noch weit entfernt, doch sollte man sich keineswegs entmutigen lassen, den Dialog zu suchen und dadurch die Entwicklung voranzutreiben. So sehr ich vielleicht auch einige Punkte diskutiere oder in Frage stelle, halte ich es für unverzichtbar, mehr PoC zu Wort kommen zu lassen, um gemeinsam an neuen Formen des Rollenspiels zu arbeiten.
Florian:
HIGHLIGHT!
Dieser Essay ist für mich das Herzstück des Bandes. Wenn du sonst nichts liest, schnapp dir wenigstens diesen hier. Voraussetzung für das Verständnis sind allerdings rudimentäre Kenntnisse von Aventurien.
Mir hat Doğan hier die Augen geöffnet. Dadurch habe ich den Schlag in die Magengrube noch sehen, aber nicht mehr ausweichen können. Umpf. Das tat weh, war aber nötig.
Der Artikel zeigt sehr gut nachvollziehbar, wie unattraktiv die Tulamidenlande für PoC eigentlich sind, und wieviel Othering bei der Erschaffung betrieben wurde. Zum Beispiel der Abschnitt über Namen (S.106f) ließ mir ein Licht aufgehen. Tatsächlich fehlen in Doğans Betrachtung aber die Aranierinnen – danke für den Hinweis, Markus!
Wenn ich den Artikel kritisieren würde, dann würde ich sagen, dass er mir nicht konstruktiv genug ist. Da sind viele „mach nicht das“ und wenige: „mach unbedingt das“ drin. Selbst die konstruktiven Vorschläge kommen mit Fallstricken und geben mir das Gefühl: Wenn ich in ein Fettnäpfchen nicht trete, setze ich meinen Fuß stattdessen ins nebenliegende. Bei der adäquaten Repräsentation von PoC kann man als Weißer nie alles richtig machen. „It’s a losing game.“
Diesen jammerhaften Eindruck kann ich dem Autoren aber kaum vorwerfen, denn vermutlich ist die Wahrheit einfach die: In einer rassistisch geprägten Welt gibt es keine perfekten Lösungen.
Oliver Baeck: Liebesgrüße von der Lebkuchenperson – Geschlechtliche Vielfalt repräsentieren
Der Essay beginnt mit Definitionen von vier Grundkomponenten der Kategorie Geschlecht. Deren Übertragbarkeit in Rollenspielsysteme sieht Baeck durch deren Orientierung an unserer Welt gerechtfertigt. Geschlechtervielfalt wird dadurch zu einer Notwendigkeit, wenngleich der Umgang damit in den jeweiligen Welten unterschiedlich sein kann. Besonders aus dem Bereich Science-Fiction fände der Autor eine kreative Umsetzung begrüßenswert.
Einschränkend räumt er ein, dass übertriebener Realismus selbst in historischen Settings keinen besonderen Spielspaß bietet. Es sollte nur so viel sein, wie es die Immersion fördert. Die Geschlechtsidentität sollte dabei nur Aspekt eines Charakters sein, eher eine bereichernde Nuance der Figur als ihre komplette Beschreibung.
Markus:
Diesem Text habe ich kaum was hinzuzufügen. Als ich aber die These las: Wenn alles gleich anerkannt ist, besteht keine Notwendigkeit für Nischenräume, dachte ich, dem würde ich sofort widersprechen. Glücklicherweise tat das der Autor auch gleich danach.
Florian:
Ich habe auch nichts hinzuzufügen. Runder Artikel, hat mir gefallen.
David Grade: Psychische Auffälligkeiten in Rollenspielen
Dieser Aufsatz hält, was der Titel verspricht: Es geht um psychische Auffälligkeiten und wie man sie im Rollenspielkontext darstellt.
Ins Spiel gebracht wird erstmals in diesem Band der Begriff der Narrative. Der Autor erkennt eine Möglichkeit zur Erstellung und Veränderung von Narrativen durch die aktive Komponente des Rollenspiels. Aus seiner Sicht bekämen die meisten Charaktere eine ICD-Einstufung (=ein medizinisches Codierungssystem für Diagnosen).
Betrachtet werden verschiedene Formen zum Umgang mit psychischen Auffälligkeiten, insbesondere der „Stabilitätswert“ und „Magisches Denken“. Dabei stellt der Autor fest: Die Sicht auf Neurodivergenzen ist vielfältig und veränderbar, daher muss nicht alles unserem irdischen Alltag entsprechen.
Der Text zielt nicht speziell darauf ab, wie mit neurodivergenten Spieler*innen umzugehen ist, sondern mehr, wie entsprechende Symptome im Spiel dargestellt werden können. Hier geht es also weniger darum, niemanden am Spieltisch zu verletzt, sondern durch eine geänderte Darstellung die eigene Sicht auf Neurodivergenzen im RealLife zu ändern oder gar eigene Narrative darzustellen.
Markus:
wie beim Text von G. Pellegrino später in diesem Band empfand ich diesen Essay auch als sehr wissenschaftlich, seine Struktur aber gleichzeitig sehr unklar. Lange habe ich mich gefragt, worum es nun eigentlich geht. Die Frage Warum ist leider noch ein bisschen geblieben.
Florian:
Ich schließe mich Markus‘ Eindruck an: Mir fehlte ein wenig die Fokussierung oder eine klare Fragestellung. Aber dafür finde ich hier mein bisheriges Lieblingszitat aus Roll Inclusive:
Die Person, die sich als Erste auf den Säbelzahntiger stürzt, um die Gruppe zu retten, wird in einer Fantasygesellschaft vermutlich hoch angesehen sein. In unserer Gesellschaft würden sie nach dem Klassifikationssystem ICD mit einer F90.0 (einfache Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörung) oder sogar einer F90.01 (hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens) versehen.
S.135 f.
♥ Danke für diesen Text ♥ Allein dafür waren die 23 € gut investiert. 😀
Ich möchte bitte als Roll Inclusive Merch ein T-Shirt, auf dem das draufsteht.
A. Doğan, F. Reiss, J, Vogt: Charaktere mit Behinderung – ein Interview mit André Skora
Die Herausgeber*Innen interviewen einen Betroffenen zum Umgang mit Sehbehinderung am Spieltisch. Der Interviewte schildert die Alltäglichkeit von struktureller Diskriminierung. Gleichzeitig sieht er jedoch positive Veränderungen und betont, sogar Stereotype seien besser als gar keine Repräsentation. Wünschenswert sei trotzdem eine Miteinbeziehung von Betroffenen, die aber auch nicht erzwungen werden solle.
Markus:
Aufgrund äußerer Umstände wurde der Essay in Interviewform geschrieben, was sehr erfrischend wirkt und auf subtile Weise das In-den-Dialog-treten demonstriert.
Als nicht-Betroffener war ich überrascht, dass hier nicht – wie in anderen Aufsätzen und oft auch zurecht – auf überstiegene Sensibilität gepocht wurde. Vielmehr setzt der Gesprächspartner auf Erfahrung und Austausch, wenngleich er Behinderung als spielrelevanten Nachteil fragwürdig sieht. Insgesamt wird hier Veränderung lieber in kleinen Schritten gefordert, im Rollenspiel eher bei Illustrationen oder in Stories. Gut fand ich das Zitat: „Hart in der Sache, respektvoll im Umgang“, da es einerseits die Notwendigkeit zur Veränderung betont aber gleichzeitig die Angst nimmt, dieses Eisen anzupacken.
Florian:
Schönes Interview. André Skora hat auch einen Rollenspielblog, den ich nur empfehlen kann. Schaut unbedingt mal beim Würfelheld rein!
Christian Vogt: Der offene Tisch – Barrierefreiheit in einem kommunikativen Hobby
Rollenspiel sei, so Christian Vogt, ein Hobby, das sich besonders gut zur Integration eignet, da die Fantasie hier wichtiger ist als der Körper. Unter dieser Prämisse geht es in diesem Essay primär um Pen & Paper und weniger um LARP.
Der Autor beschreibt eine Reihe von Barrieren, die im Rollenspiel auftreten können. In diese Aufstellung seien Ergebnisse von Befragung Betroffener miteingeflossen.
Im Wesentlichen lassen sich drei Kategorien von Barrieren aufstellen: Mobilitätsbarrieren, kommunikative Barrieren, visuelle Barrieren und chronische Krankheiten. Für jeden dieser Bereiche gibt der Autor nach einer kurzen Darstellung Vorschläge zur Kompensation, sowie Spielempfehlungen. Sein Fazit ist: Es bleibt viel zu tu, aber zumindest das Schaffen von Bewusstsein stellt einen ersten Schritt dar.
Florian:
Hier fange ich mal an, der Abwechslung halber. Auch weil mir dieser Artikel hart auf die Füße getreten ist und ich Redebedarf habe.
Vorab: Ich begrüße es, wenn ein Buch wie Roll Inclusive mich zwischendurch auch mal wütend macht. Ich habe mir das schließlich nicht zum Wohlfühlen geholt. Da hätte ich mich hart im Thema vergriffen, wenn ich das gewollt hätte. Wenn ich also sauer werde, ist das erstmal ein Hinweis darauf, dass hier ein wunder Punkt getroffen wurde.
Hier der Kontext, in dem der Fuß auftaucht, der mich getreten hat:
Wenn man eine Person mit Sprach- oder Sprechstörung am Spieltisch hat, so könne es sein, dass die Mitspielenden das als störend empfinden, schreibt Vogt. Vor allem für in eine in-character Unterhaltung könne dies als „Stimmungskiller“ empfunden werden. Zu diesem Problem hat der Autor folgendes zu sagen:
Dies ist allerdings nicht das Problem des Menschen mit Sprach- oder Sprechbehinderung, sondern seines Umfelds, das dem scheinbaren Problem leicht mit Reflektion, Geduld und Empathie begegnen kann, womit dem flüssigen Spiel nichts mehr im Wege stehen sollte.
S. 166
Falls du jetzt denkst, ich würde mich daran stören, dass hier das Problem im Umfeld gesucht wird, und nicht bei der Person, die stottert, irrst du dich. Da hat Vogt völlig recht. Das ist fast schon analytisch wahr: Wenn ich nicht in Stimmung komme, dann bin ich es, der ein Problem hat. Wenn es meine Immersion ist, die leidet, dann ist das mein Problem. Es ist erstmal unerheblich, was die Ursache des Problems ist, oder wer hier „Schuld“ haben könnte. Fest steht: Diejenige, die ein Problem hat… hat ein Problem.
Was mich aber tierisch aufregt, ist der „Lösungs“vorschlag, den der Autor hier so lapidar raushaut: Du könntest dem Problem „leicht mit Reflektion, Geduld und Empathie begegnen“. Mich stört hier das Wort leicht. Das impliziert nämlich, Geduld oder Empathie seien mühelos. Es klingt auch so, als sei all dies etwas, das man selbstverständlich von anderen erwarten dürfe. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Geduld und Empathie aufzubringen, ist anstrengend. Das kostet Energie und Mühe. Manchmal kann man das einfach nicht aufbringen. Und das ist auch okay.
Bitte nicht missverstehen: Ich will hier nicht wieder den Spieß umdrehen. Die Mühe, die Empathie kostet, ist auch wieder nur ein Problem derjenigen, die sie gerade aufbringen soll, und eventuell daran scheitert. Das soll nicht das Problem der Person sein, die zum Beispiel stottert. Ich wehre mich einfach nur gegen die Vorstellung, Geduld und Empathie wären nicht das Ergebnis von Arbeit. Arbeit, die auch mal auszehren kann. Arbeit, die alles ist – nur nicht leicht.
Ist es übertrieben, dass ich mich hier an einem einzigen Wort so aufhänge? Vielleicht. Andererseits schließt der Autor seinen Artikel mit ähnlichen Worten:
„Manchmal ist Inklusion gar nicht so aufwändig, wie man zunächst denkt. […] Redet miteinander und zeigt Empathie!“
Also, ich denke, dass Empathie durchaus aufwändig sein kann. Dies herunterzuspielen, tut niemandem einen Gefallen.
Jetzt gebe ich aber erstmal ab an…
Markus:
Als es hieß, dass für den Essay Betroffene befragt wurden, habe ich mich natürlich als Statistiker nach dem Sample und der Form der Datenerhebung gefragt, die jedoch nicht erläutert wurden. Immerhin ist der Autor selbst auch z.T. betroffen.
Sehr schwierig finde ich seine Erörterung der Barrieren und Kompensationsmechanismen. Zum Beispiel sagt er, dass Online-Runden von Mobilitätsbarrieren nicht betroffen sind. Wie es mit der physischen Verfügbarkeit von entsprechender Elektronik oder Software aussieht, wird dabei vernachlässigt, obwohl dies durchaus mit den erwähnten Regelwerken etc. vergleichbar scheint. Schon beim nächsten Punkt, den kommunikativen Barrieren, wird die Verantwortung allein auf das Umfeld bezogen, die als einzige Träger*innen des Problems seien. Ohne Einschränkung werden hier Empathie, Rücksicht und Geduld gefordert. Einseitigkeit ist aus meiner (und maraskanischer) Sicht nie eine gute Sache. Mir ist klar, dass es um die Förderung einer benachteiligten Gruppe geht, aber ich muss mich Florian anschließen: die Leichtigkeit, mit der die Anstrengung der anderen eingefordert wird, finde ich schon übergriffig.
Schwierig finde ich, wenn der Autor bei den visuellen Barrieren reine Audioerlebnisse vorschlägt, obwohl damit wiederum die kommunikativen Barrieren ausgelöst werden. Hier wäre der Hinweis gut, wie komplex es sein kann, zu versuchen, alle Barrieren zu überwinden.
Insbesondere bei Conventions wird einiges an Zusatzausstattung gefordert: Spezielle Locations, eigene Räume, besondere technische Ausstattung und zusätzliches Sonderpersonal. Zwar schränkt der Autor am Ende ein, dass das alles Geld kostet, verweist dabei aber lediglich auf die Möglichkeit von Förderprogrammen mit dem einzelnen Hinweis auf die „Aktion Mensch“. Auch hier werden die Geforderten wieder mit ihrem Päckchen allein gelassen. Ich finde es nicht gut, wenn eine Gruppe sagt: „Das ist, was wir brauchen und jetzt guckt mal, wie ihr das hinbekommt“. Welche Möglichkeiten gibt es denn seitens der Betroffenen, hier zumindest in Beratung und Planung zu unterstützen oder auf irgendeine andere Weise aus der Rolle der passiven Hilfs- und Rücksichtsbedürftigen herauszukommen?
A. Doğan, F. Reiss, J. Vogt: Gemeinsam verschiedene Wege gehen – zur Bedeutung von Intersektionalität
Dieser Essay erklärt den Begriff der Intersektionalität. Gemeint ist, dass auf fast niemanden nur einer der bislang genannten Aspekte (Weiß/PoC, Mann/Frau/Divers, etc.) passt. Gerade wenn man in mehr als einer Hinsicht einer marginalisierten Gruppe angehört, ergäben sich ganz eigene Herausforderungen, die nicht abgedeckt werden, wenn man die Gruppen einzeln betrachtet. Intersektionalität biete auch Ansatzpunkte für Koalitionen und Verständnis.
Wie Menschen können auch Rollenspielcharaktere intersektional sein. Die Autor*innen ermuntern dazu, Diversität nicht nur einzubringen, sondern diese auch vielschichtig zu halten. Sie betonen: Gerade Rollenspiel bietet besondere Möglichkeiten der Einfühlung in Andere.
Markus:
Inhaltlich bin ich mit dem Artikel konform, aber ich habe mich gefragt, ob dieser Essay nicht weiter nach vorne gehört hätte, möglicherweise bereits in Teil 1. In einigen der früheren Aufsätze hätte ich mir bereits Hinweise auf Diskriminierung marginalisierter Gruppen untereinander gewünscht. Außerdem sähe ich so das Risiko vermindert, dass ein einzelner Diversity Aspekt (ok, noch mit Brechung) zum einzigen Charaktermerkmal wird: Diese Person ist lesbisch, jene hat eine andere Hautfarbe und die da hinten eine körperliche Beeinträchtigung.
Das Thema Intersektionalität erscheint hier als ein weiterer Aspekt, aus meiner Sicht gehört er aber auf die Metaebene. Diese übergeordnete Bedeutung vermisse ich auch in der Dramatik des Essays. Er plätschert ein wenig vor sich hin, wo er doch auch ein kräftiger Strom sein könnte, der Barrieren zwischen Gruppen einreißt. Gefehlt hat mir auch eine Erwähnung von inneren Konflikten intersektional Betroffener: Der Wunsch, zu einer Gruppe zu gehören, ist bei Menschen vermutlich nicht selten. Muss ich mich dann für einen meiner Aspekte entscheiden, wenn die betreffenden Gruppen untereinander gegnerisch eingestellt sind? Wie werte ich hier und welchen Konflikt bedeutet das für mich?
Florian:
Hm? Sind wir schon bei Intersektionalität? Sorry, ich schmolle noch über das „leicht“. Hab hier nichts zu sagen.
Markus:
Nimm’s nicht so schwer ;b
Roll Inclusive – TEIL 3
Judith Vogt: Auf Augenhöhe – Von Hierarchie, Community-Standards und was Feminismus damit zu tun hat
Hierarchien sind immer Teil unseres Lebens. Aber sie müssen nicht zwingend schädlich sein.
Mit dieser Feststellung leitet die Autorin in die Betrachtung der mit Hierarchie verbundenen Machtkomplexe ein.
Sie unterscheidet hier drei Richtungen der Macht: um, über und mit. Diese Richtungen findet sie auch im Rollenspiel wieder. Machtformen greifen hier nicht nur auf allen Ebenen (Person – Spieler*in – Charakter), sondern übertragen sich auch wechselseitig, wodurch sie sich selbst verfestigen.
Rollenspiel erscheint der Autorin als ein besonders kooperatives Medium, das vergleichsweise viel Möglichkeit zu Dialog und Teilhabe bietet. Allerdings gibt es auch hier Machtmechanismen zur Ausgrenzung – zum Beispiel Gatekeeping.
Als Lösung empfiehlt Vogt Community Standards. Das Aushandeln solcher Standards könne für jede Gruppe hilfreich sein. Vogt erläutert dies anhand einiger Beispieltools:
- X-Karte,
- Lines & Veils,
- Sctiptchanging,
- Offene Tür.
Markus:
Wieder suchte mein weinendes Herz vergeblich nach Foucault, was insbesondere bei der Betrachtung von Machtmechanismen aus meiner subjektiven Sicht sehr nahe läge. Die vorgestellten Tools klangen für mich zunächst sehr technisch und fremd. Bei all diesen möglichen Mechanismen habe ich mich gefragt, ob dies nicht auch auf Kosten der Immersion geht und so das Spielerlebnis schmälert. In meinen bisherigen Gruppen habe ich so etwas bislang nicht gebraucht. Wir haben hier immer auf den offenen Dialog gesetzt, eine Möglichkeit, die auch Judith Vogt als möglichen Mechanismus anspricht. Die Tatsache, dass solche Mechanismen aber entwickelt wurden, heißt für mich, dass dieser Dialog nicht in allen Gruppen gegeben ist, bzw. nicht allen Betroffenen so leicht fällt. Insofern denke ich, dass zumindest das offene Gespräch über solche Mechanismen hilfreich sein kann, indem es Machtstrukturen und Kommunikationsstrukturen aufdeckt und vielleicht erst den offenen Dialog eröffnet.
Ganz am Rande habe ich mir bei diesem Aufsatz wieder die Frage gestellt, inwiefern Rollenspieler*innen gesamtgesellschaftlich gesehen auch eher marginalisierte Personen darstellen.
Florian:
Pah, Safety-Tools. Wozu braucht man das, wenn man miteinander kommunizieren kann? Und das Kommunizieren ist doch ohnehin eine Grundvoraussetzung des Rollenspiels. Wenn du das nicht kannst – zum Beispiel weil die Kommunikationsatmosphäre in deiner Gruppe nicht gut ist, dann werden dir auch keine Safety-Tools helfen.
Das dachte ich, bis im Blog Nerd-Gedanken den Artikel X-Karte – Braucht man die wirklich? las.
Hier habe ich gelernt: Manchmal weiß man nicht, was einen triggern wird. Aber wenn man getriggert wurde, ist Kommunikation nicht mehr „leicht“ möglich. Dann geht vielleicht gerade noch das Antippen einer X-Karte.
Ansonsten ist mir in diesem Artikel ein seltsames Non-Sequitur aufgefallen:
Die Autorin erläutert ein Gegenargument gegen Safety-Mechanismen: Man könne diese ja auch missbrauchen. Okay, denke ich, jetzt freue ich mich drauf, zu lesen, wie sie dieses Argument entkräftet. Sie schreibt:
Safety Tools dienen der persönlichen emotionalen Sicherheit. Rollenspiele finden auch in Grauzonen statt, Charaktere treffen grausame Entscheidungen, und Drama hält Spiel*innen in Atem.
S. 207
Ich habe keine Ahnung, was das mit dem Missbrauch der Sicherheitswerkzeuge zu tun hat. Darauf kommt die Autorin auch nicht wieder zurück. Schade – und etwas irritierend.
Elea Brandt: Endboss Kulturklischees – Tipps für den kultursensiblen Weltenbau
Eigene Fantasy-Welten erschaffen und in kein Fettnäpfchen treten, wenn es darum geht, Kulturen zu entwerfen. Darum dreht sich dieser Essay. Im kritischen Fokus stehen kulturelle Aneignung, sowie internalisierte Stereotype und Klischees.
Wenngleich Klischees Sinn und Nutzen haben können, bieten sie zahlreiche Gefahren und schädliche Einflüsse. Stereotypen haben performativen Charakter und beeinflussen unsere Begegnungen mit den betreffenden Gruppen auch im Reallife.
Nach einer neuen Definition von kultureller Aneignung schildert die Autorin diese nicht als verboten, sondern verweist auf das notwendige Fingerspitzengefühl innerhalb bestimmter Parameter.
Archetypen, wie sie aus verschiedenen Systemen bekannt sind, bieten aus ihrer Sicht allerdings viele Nachteile. Dem Titel entsprechend sieht E. Brandt die Arbeit gegen Klischees als Kampf und bietet auch gleich vier Waffen: Bewusstsein Schaffen, intensive Recherche, Verbündete suchen, Kreativität.
Markus:
Die Definition kultureller Aneignung hat mir hier besser gefallen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema empfand ich aber als weniger offen als im (noch folgenden) Text von Ben Maier. Enttäuscht war ich von der Definition des Begriffs Kultur. Diese stammt von einer Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist mit Sicherheit keine schlechte Quelle, doch bei diesem gleichermaßen zentralen wie sensiblen Begriff hätte ich mir auch etwas Diskussion aus den Kulturwissenschaften, insbesondere der Ethnologie gewünscht, wie sie z.B. bei J. Peoples u. G. Bailey, Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology erfolgt.
Insgesamt hat mich dieser Essay an die Artikel über Rassismus erinnert. Er geht in eine ähnliche Vorwurfsschiene. Die Rezeption der genannten Rollenspielkulturen scheint fokussiert auf negative Aspekte. Wieder dient Aventurien als Beispiel, doch sind PoC dort nicht nur, wie im Artikel dargestellt, die Moha, sondern auch Kemi, Nivesen und Tulamiden. Diese Kulturen sind anders, aber sicher nicht unzivilisiert. Beispiele hierfür wären die Hochkultur der Wudu oder das Diamantene Sultanat. Selbst die Orks in Aventurien besitzen eine ausgefeilte Zivilisation mit Stammessystem, Religion und Spezialisierungen. Leider fehlt in dieser einseitigen Schilderung auch, dass in Aventurien die (vermutlich weißen) Bosparaner als barbarische Zerstörer der deutlich zivilisierteren tulamidischen Großreiche dargestellt werden. Auch in der Gegenwart gelten Aranien und die Tulamidenlande im Vergleich mit Weiden oder Tobrien noch als weitaus kultivierter.
Völlig vergessen wurden aventurische Kulturen, die keine klare irdische Entsprechung haben, wie das ehemalige Nostria oder Maraskan. Diese wären tolle Beispiele gewesen für die in diesem Essay geforderte Kreativität und Einzigartigkeit. Und genau das vermisse ich: Bei all den Gefahren und Einschränkungen im Weltenbau – wie soll ich’s denn machen? Und was sollte überhaupt das Ziel einer Welt sein? Selbst die vorgestellten „Waffen“ erscheinen mir bei der Beantwortung dieser Fragen wenig hilfreich, da auch sie wieder unter diversen Einschränkungen stehen. Insofern hinterlässt mich dieser Artikel ohne neuen Wegweiser zum Weltenbau, nachdem er meine alte Landkarte zerrissen hat.
Florian:
Ich glaube, dieser Artikel ist perfekt dafür geschaffen, auf viele verschiedene Füße zu treten.
Selbst wenn ich – anders als Markus – inhaltlich mit diesem Artikel voll mitgehe und mir keine differenziertere und fairere Betrachtung Aventuriens wünsche, selbst wenn ich alles abnicke, was der Essay problematisiert, bleibe ich am Ende vor einem Scherbenhaufen stehen und weiß nicht weiter. Und dann tritt mir Elea Brand auch noch gegen das Schienbein.
Ich erkläre das mal kurz:
Angenommen, ich bin ein weißer Mann und ich möchte die Kulturen einer fiktiven Welt erschaffen. Ich möchte nicht nur weiße Kulturen erschaffen, sondern auch Kulturen of color repräsentieren, damit möglichst viele Menschen Lust haben, in meine Welt abzutauchen.
Wie gehe ich jetzt vor?
Elea Brandt schlägt vier Schritte (=„Waffen“) vor:
- Selbstreflektion und Sensibilisierung: Soweit du kannst, solltest du Stereotype erkennen, die du internalisiert hast, und dich dann von diesen verabschieden.
- Gute Recherche.
- Expert*Innen, Betroffene, Insider und/oder Sensibility Reader finden und befragen.
- Kreativ sein. Also nicht nur die Ergebnisse der Recherche reproduzieren, sondern daraus Neues schaffen. Zum Beispiel mal eine Welt ohne weißen Kolonialismus.
Soweit, so gut. Das sieht erstmal nach konstruktiven Vorschlägen aus. Allerdings werden im Essay die Punkte 2 und 3 gleichzeitig derart problematisiert, dass ich nicht sehe, wie ich die sinnvoll stemmen könnte.
Hier die Probleme:
Eines muss dabei immer klar sein: Informationen über uns fremde Kulturen zu sammeln ist harte Arbeit und nicht mit einem Besuch auf Wikipedia erledigt.
S. 221
Klar, stimmt. Das ist viel Arbeit. Aber die alleine reicht nicht aus, so Brandt. Egal, wieviel Literatur ich darüber lese, nichts ersetzt die Erfahrungen von Insidern. Brand stellt hier klar: Du bist auch keine Insider*in, wenn du mal ein Auslandssemester gemacht hast:
Ein Urlaub in Ägypten oder ein Auslandssemester in Südamerika sind sicherlich informativ, reichen aber nicht an die Erfahrungen der Einheimischen heran. Ebenso wenig der private Kontakt zu People of Color, auch wenn er sicher hilfreich ist.
S. 222
Klar, stimmt auch. Also brauche ich Expert*innen, die ich zu rate ziehen kann. Bei diesen gibt es zunächst die Hürde, dass ihre Arbeit, die ja für mich wertvoll ist, auch gewertschätzt werden soll, bestenfalls monetär. Aber wenn ich schon Geld in die Hand nehme, sollte ich vielleicht überlegen, besonders sensible Themen vielleicht direkt von einer Person of Color angehen zu lassen, und nicht als Weißbrot alles selbst zu machen.
Doch selbst wenn ich das alles beachte – selbst wenn ich genug materielle Ressourcen habe, um Expert*innen heranziehen zu können, und sensible Themen abzugeben – selbst dann darf ich nicht beruhigt aufatmen und meine fiktive Welt ohne Angst der Welt präsentieren, denn: Meine Expert*innen sprechen nicht für eine ganze Gruppe.
Keine*r von ihnen ist in der Lage, universell für alle Angehörigen seine*r Gruppe zu sprechen
S. 222
Das heißt doch: Egal, wieviel Mühe (und Geld) ich investiere, perfekt machen geht nicht.
Das ist der Scherbenhaufen, von dem ich eingangs sprach, und vor dem ich mich da sehe. Konfrontiert mit all diesen Hürden und Problemen, wäre mein erster Instinkt, die ganze Scheiße einfach hinzuwerfen und einfach nur das zu machen, was ich ohne Probleme kann: Eine rein weiße Fantelalterwelt. Damit hätte ich aber in Sachen Repräsentation extrem harte Rückschritte gemacht.
Mein Eindruck vom Endboss Kulturklischees ist, dass das ein Endgegner ist, den ich nicht besiegen kann.
Ich finde das furchtbar frustrierend. Ganz wichtig ist mir dabei aber: Das ist nicht Elea Brandts Schuld. Das ist nicht das Ergebnis von unsauberer Argumentation. Im Gegenteil – alles, was ich gerade zusammengefasst habe, würde ich so auch unterschreiben Das sind einfach die Fakten; so ist halt die Welt. Es gibt keine perfekte Lösung für diese Probleme, solange die Welt selbst nicht perfekt ist.
Ich werfe Brandt dennoch etwas vor, denn eine Sache empfand ich als wirklich zynisch.
Weltenbau ist ein spannendes, komplexes Thema mit unermesslichen Möglichkeiten jenseits irdischer Klischees. Man muss sich nur trauen, sie auszuschöpfen.
S. 223
Das ist der Tritt gegen das Schienbein, den ich schon angesprochen habe: Ich soll mich halt einfach trauen. Einfach nur Mut haben. Da möchte ich doch mal zurückfragen:
- Woher soll ich nach diesem Essay den Mut dafür aufbringen?
- Und wie trägt der Mut zur Lösung der dargestellten Probleme bei?
Aurelia Brandenburg: „Das war halt so!“ – Zur Problematik von historischer Korrektheit, Authentizität und Fantastik
Jede Narration liegt irgendwo zwischen Fiktion und Fakt. Das ist die Grundthese dieses Essays.
Geschichte und Geschichtsschreibung stellen lediglich eine Interpretation von Quellen dar. Sie seien deshalb nicht mit „Wahrheit“ gleichzusetzen. Dennoch bilde die Vergangenheit ein konstitutives Element von Gesellschaften, wenn auch mitunter in alternativen Fakten. Das Postulat absoluter Authentizität sei nicht durchzuhalten und gerade im Rollenspiel nicht zielführend. Vielmehr wird auf die Gefahr des Missbrauchs verfälschter oder einseitiger Geschichtsbilder verwiesen.
Markus:
Das Thema hat mich aus beruflichen Gründen natürlich besonders interessiert. Bedauerlich fand ich deshalb, dass die Autorin sich beim Thema Vergangenheitsrekonstruktion ausschließlich auf Schriftquellen bezog und die Archäologie völlig übersehen wurde. Inhaltlich ist das entscheidend, da zwar auch die Archäologie interpretiert, in ihrer Quelle, dem Boden, jedoch das arbiträre Moment der Autor*innen und somit eine wichtige Fehlerquelle fehlt. Möglicherweise durch diese Enttäuschung beeinflusst, wurde der Bezug für mich zunehmend schwammig. Es wurde beispielsweise nicht hinterfragt, ob eine Burg in einem Roman zwingend mit jeder irdischen Burg übereinstimmen muss. Ebenso muss das Bild einer einzelnen Romanburg nicht als Interpretation aller irdischen genutzt werden. Beim genannten Beispiel des Barbarensturms habe ich nicht an den angeblich offensichtlichen Mongolensturm gedacht, sondern an die sogenannten Seevölker, meinetwegen auch an Klischeevorstellungen der Wikingereinfälle. Ist vielleicht auch berufsbedingt, zeigt aber, dass die Bilder in den Köpfen sicher nicht immer die gleichen sind.
Leider empfand ich den Aufbau des Artikels als sehr verwirrend und unstrukturiert. Mir war nicht wirklich klar, wann ein zentraler Punkt genannt, relativiert oder widerlegt wurde. Außerdem hat mir ein wichtiger Bezug gefehlt, auch wenn dieser vielleicht nur zum erweiterten Themenfeld Rollenspiel gehört. Die Authentizitätsfrage ist zunehmend im LARP aber vor allem im Reenactment ein zentrales Thema. Da hier ein Übergangsbereich zwischen Geschichtsforschung und Rollenspiel vorliegt, halte ich die Erwähnung und Betrachtung im Themenfeld dieses Artikels für entscheidend. Sie zeigt eindrücklich die oft extreme Ausformung des Wahrheitsanspruchs gewisser Narrative, mitunter auch in einer rollenspielerischen Darstellung angeblich historischer Gesellschaften.
Florian:
Ich würde gerne öfter mal radikal andere Meinungen zu den Essays haben als Markus. Hier habe ich hingegen radikal denselben.
Ich habe außerdem lange überlegt, ob es jetzt total unangebracht ist, darauf hinzuweisen, dass Aurelia Brandenburg ohne Zweifel der schönste Name ist, den man in meinem Bücherregal finden kann. Jetzt habe ich mich entschieden, mich einfach mal zu trauen.
Ben Maier: Illustration – Visuelle Kommunikation im Spannungsfeld zwischen Stereotypen und Vielfalt
Der Essay dreht sich um Illustrationen in Rollenspielprodukten. Ben Maier ist Illustrator, schreibt also aus Expertensicht. Der Essay gibt einen Überblick „was es bei Konzeption und Umsetzung alles zu beachten gilt, um Stereotypen aufzubrechen und Diversität in die Spielwelt einzuführen.“
Er beschreibt unter anderem, inwiefern Stereotype die Lesbarkeit von Darstellungen erleichtern, obwohl Illustrationen eigentlich eine Chance zum Gegensteuern wären. Das Thema kulturelle Aneignung wird auch hier betrachtet. Diesmal wird ausdrücklich keine eindeutige Lösung dieses Konflikts in Aussicht gestellt.
Der Essay erläutert auch das Spannungsfeld zu den Auftraggebenden. Letztlich geht es bei Rollenspielpublikationen auch darum, Geld zu verdienen. Daher sind oft Kompromisse nötig.
Nach einem Exkurs zur Wirkungsweise von Illustrationen im Gehirn werden verschiedene Darstellungstechniken erwähnt, inklusive deren Auswirkungen auf die Rezipienten.
Im Anschluss bietet der Essay eine Liste von Fragestellungen, mit deren Hilfe Interessierte selbst Rollenspielsysteme anhand ihrer Illustrationen hinterfragen können. Dazu gibt es noch Tipps zum Aufbau eigener Darstellungen.
Zum Abschluss reflektiert der Autor auch seine eigenen Arbeiten und gibt zu, dass es ihm trotz aller Bemühungen auch nicht gelingt, perfekt zu sein.
Markus:
HIGHLIGHT!
Dieser Artikel wirkte durch die Offenheit der Darstellung von Spannungsfeldern sowohl erfrischend als auch befreiend. Hier ging es nicht darum, die Vorwurfskeule (3W20, garantierter tödlicher Treffer) zu schwingen, sondern ehrlich zuzugeben, was alles an den Erschaffer*innen von Rollenspielsystemen zieht oder Druck ausübt. Das Fazit, dass Repräsentation bei den Autor*innen liegt, aber zumindest im wirtschaftlichen Bereich abhängig von Auftraggeber*innen und Zielpublikum ist, lässt deutlich werden, wie komplex die Prozesse zum Thema Diversity sind. Meine Perspektive, für wen dieses Buch gedacht ist, hat sich dadurch noch einmal deutlich erweitert. Die Selbstkritik des Autors erzeugte bei mir nicht nur einen besonderen Eindruck von Authentizität, sondern relativierte für mich auch die Forderungen zur Diversity: Wir müssen dahin und schnell, wenn es geht. Dabei sollten wir aber weder uns selbst noch die anderen Laufenden niedertrampeln.
Florian:
HIGHLIGHT!
Ja, wieder kein Streit mit Markus. Aber dieser Artikel war äußerst bereichernd. Und – das ist jetzt persönlich gemeint – der Essay klang äußerst sympathisch.
Hier schreibt jemand, der sich eines Problems bewusst ist, dieses anschaulich beschreibt, und best practices anbietet, wie man Kompromisse in einer nicht perfekten Welt findet. Hier gibt es keine Augenwischerei, die die Probleme herunterspielt und mir sagt, ich solle mich halt einfach trauen, oder ich könne den Problemen „leicht“ begegnen, wenn ich nur jede Menge emotionelle Arbeit investiere. (Ja. Ich bin darüber immer noch nicht hinweg.) Der Essay zeigt sich vorbildlich transparent und vor allem praxisnah. Irritierenderweise wirkt er dadurch wie der erste durchgehend konstruktive Essay des gesamten Bandes, obwohl all die angesprochenen Lösungen inhärent unbefriedigend sind.
Außerdem habe ich hier Einblick erhalten in die Perspektive eines Illustratoren. Aus dieser Perspektive durfte ich noch nie aufs Rollenspiel blicken, deshalb empfinde ich diesen Artikel wirklich als horizonterweiternd.
Avery Alder: Queeres Spieldesign
Der Essay ist ein Transkript eines Vortrags; aus dem Englischen handübersetzt für Roll Inclusive von Lena Richter.
Besprochen werden die Fragen: Wie funktioniert queere Repräsentation in Spielen? Wie wichtig ist sie? Danach wird festgehalten: Queere Repräsentation sei nicht das Ende der Fahnenstange, wenn man ein queeres Spiel designen möchte. Man könne nicht „einfach nen Schwulen draufpappen“, sondern müsse auch tradierte Erzählstrukturen aufbrechen. Dies würde die Teile der Geschichte freilegen, welche „von Vorurteilen geprägt sind oder Menschen ausschließen“. (S. 266)
Das gleiche gelte auch für Spielmechanismen.
Es werden sechs Kategorien vorgestellt, die dabei helfen können, Strukturen und Mechanismen aufzubrechen. Zu jeder Kategorie gibt es praktische Beispiele aus Rollenspielsystemen.
- Keine Hoheit über eigenen Charakter,
- Charaktere ganz abschaffen,
- Ungewissheit und Unbestimmtheit,
- Ausleuchten von Machtverhältnissen,
- Agenda ohne Macht,
- das Absurde annehmen.
Markus:
Dieser Artikel hat mich leider verloren. Die aufgeführten Beispiele erinnern mich z.T. eher an Brett- oder Gesellschaftsspiele. Insbesondere im Streichen von Charakteren oder zumindest der Charakterhoheit sehe ich eventuell Möglichkeiten zur Selbsterfahrung aber kaum Raum zur persönlichen Ausgestaltung. Was also zu einer Befreiung aus eingefahrenen Zwängen führen soll, bietet mir einfach ein anderes, sehr enges Korsett. Mich würde interessieren, wie viele Spielende solcher neuen Systeme eine wirklich tiefgehende Immersion erfahren, wie sie bei den üblichen Rollenspielsystemen immer zentraler erscheint.
Das letzte Beispiel erscheint mir fast aus einem therapeutischen/esoterischen Kontext. Das ist nichts Schlechtes, erfordert aber eine erweiterte Fassung des Begriffs Rollenspiel. Daneben gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt: Ich bestreite nicht, dass Rollenspiele eine äußerst therapeutische Wirkung haben können – ganz im Gegenteil. Leider musste ich (im LARP) bereits mitbekommen, was passieren kann, wenn diese Wirkung ohne professionelle therapeutische Begleitung freigesetzt wird: Der mentale Zusammenbruch einer Person, deren Türchen alle geöffnet wurden, ohne dass jemand rechtzeitig die Reißleine zog oder die Möglichkeit hatte, ihr auch beim Schließen wieder zu helfen. Insofern: Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
Als queerer Mensch frage ich mich außerdem, ob es in diesem Essay wirklich um Aspekte der queeren Community geht oder eher um eine deutlich erhöhte Metaebene: eingefahrene Bahnen brechen und den Horizont erweitern, sozusagen bisherige Rollenspielsysteme zu queeren. Aus meiner Sicht schon sehr abstrakt und ätherisch aber vielleicht kein schlechter Punkt am Ende der Einzeltexte.
Noch eins: wirkliche Punkte zur Darstellung/Behandlung/Miteinbeziehung queerer Menschen habe ich hier nicht gefunden.
Florian:
Wenn es um queeres Spieldesign geht, kommt man um Avery Alder (Monsterhearts, The Quiet Year, u.v.m.) nicht herum. Deshalb ist es wichtig (und großartig) auch sie zu Wort kommen zu lassen in diesem Band.
Ich schreibe das jetzt so, als hätte ich das schon längst gewusst; tatsächlich bin ich erst über Roll Inclusive auf sie aufmerksam geworden und habe dann entdeckt, wie präsent sie ist. Das allein rechtfertigt doch wohl diesen Artikel.
Inhaltlich bin ich dieses Mal nur so halb bei dir, Markus: Mein Eindruck ist der, dass Immersion bei den üblichen Rollenspielen immer weniger zentral wird. Der Trend geht in meinen Augen hin zu etwas, das ich cineastisches Spiel nenne. Damit meine ich nicht Action pur, sondern dass man nicht nur durch die Augen des eigenen Charakters blickt, sondern auch die Gesamt-Dramaturgie im Auge behält, um filmreifere Szenen zu generieren. Ich vermute hier einen Einfluss von Actual Plays, bei denen es wichtig ist, auch das Publikum zu unterhalten, und meine Güte, ich schweife hier komplett ab. Worauf ich hinaus will: Die Öffnung des Spiels hin zur Metaebene – das ist ein Trend, den ich wahrzunehmen glaube. Und dadurch sehe ich auch einen Markt für Meta-Spiele.
Ich weiß nicht, ob man dafür den Begriff Rollenspiel erweitern muss. Was ich nur mitbekommen habe: Diese therapeutischen Spiele, wie du sie ganz treffend nennst, sind schon da.
Ich empfehle hier den Genderswapped-Podcast, in dem diese Spiele „Message Games“ genannt werden. (Weil sie eine Message haben.) Der Podcast ist von Lena Richter und Judith Vogt, also der Übersetzerin dieses Essays und einer Mitherausgeberin des Bandes.
Lena Richter: Toolkit – Werkzeuge für mehr Diversität im Rollenspiel
Markus:
Den letzten Teil des Buches möchte ich zusammenfassen. Als Handreichung zu mehr Diversity im Rollenspiel gibt Roll inclusive ein paar Würfeltabellen. Da geht sicher vielen P&P Spieler*innen das Herz auf. Die geschilderten Möglichkeiten bieten aus meiner Sicht viel Potential, auch Schranken in unserem Hirn zu öffnen oder zumindest zu thematisieren. Besonders gut gefielen mir auch die Bullshit Bingos. Diese Form wird ja auch in Blogs zunehmend genutzt und bietet eine witzig spielerische und dennoch funktionale Art, sich der Auseinandersetzung mit Klischees und Stereotypen zu nähern.
Die folgenden Nanogames setzen hier an, indem sie durch das Medium Rollenspiel die Möglichkeiten zum Erfahren von Diversity vertiefen. Zwei davon haben mich wirklich fasziniert:
- Spiele Rollenspieler*innen auf einer Convention (Con-Tisch 2.04);
- Spiele das (NSC-)Personal eines Etablissements in einer Rollenspielwelt (Team Meeting).
Beide halte ich für hervorragend, nicht nur um Diversity zu erleben, sondern auch um mehr Gefühl für andere Charaktere zu erlangen.
Mit den anderen Nanogames konnte ich allerdings kaum etwas anfangen. Rollenspiel ist für mich immer noch Spiel und spielen sollte auch Spaß machen. Bei einigen musste ich mehrfach lesen, wie denn nun die Mechanismen funktionieren sollen und frage mich immer noch, ob ich es verstanden habe. Vor allem aber fehlte mir der Spaßfaktor. Gut, wenn diese Nanogames eine erzieherische Maßnahme sein sollen, dann ist für Spaß kein Platz. Ich bezweifle aber, dass es ein guter Weg zum Aufbau von Verständnis ist, wenn die Spielenden sich fragen „Warum mache ich das hier eigentlich?“
Florian:
Ich möchte hier eigentlich nur hinzufügen, was für eine Visionärin Lena Richter ist, und wie sehr sie ihrer Zeit voraus war. Eines ihrer Nanogames dreht sich um eine Spielrunde auf einer Rollenspiel-Convention. Es geht um lösbare und unlösbare Hindernisse im Spiel. Sie schrieb irgendwann zwischen Sommer 2018 und Herbst 2019:
«Mein Charakter hat eine schwere Grippe und muss dringend ins Bett» ist eher nicht lösbar – GEHT MIT SOWAS NICHT AUF EINE CON, LEUTE!
S. 290
♥♥♥ Danke ♥♥♥
Ausblick
Geschafft. Das waren alle Essays in Roll Inclusive.
Du fragst dich jetzt bestimmt:
- Wo ist das tl;dr?
- Was ist das abschließende Fazit von Markus und Florian?
- Gibt es noch mehr süße Hundefotos?
Das alles besprechen wir in einem eigenen Artikel. Dort kommen wir auch auf einige allgemeine Aspekte zu sprechen, die sich durch das gesamte Buch ziehen. Lies also direkt weiter im zweiten Teil: Markus sucht Endnoten & Florian zählt Verben!





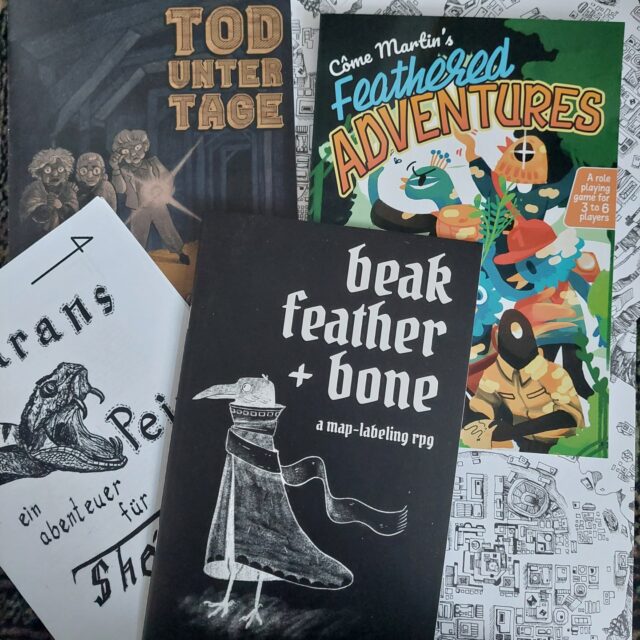
Aaah, der alte Unterschied von Tradition und Überrest, verstehe.
Aber zur Neutralität, es kommt natürlich auf das historische Erkenntnisinteresse an, wie nah eine Quelle an der „Wahrheit“ liegt.
Wenn ich mir die kulturhistorische Frage stelle wie ein Städter in der Frühen Neuzeit wohl ao gedacht hat, dann ist ein Tagebucheintrag ein genauso harter Fakt wie eine Tonscherbe aus dem alten Babylon, wenn man sich fragt wie die ihre Töpfe wohl gemacht haben.
Glaube ich nicht. Der Söldner könnte in sein Buch Dinge geschrieben haben, die man damals für wahr, gut oder richtig hielt, auch wenn wir heute anderer Meinung sind.
Die Zusammensetzung der Tonscherbe bleibt die gleiche, egal, was wir von ihr halten. Sie gibt Aufschluss über Brenntechnik, Materialvorkommen, Magerungsart und erzählt so über Menschen ohne dass denen klar war, dass sie eine Quelle erschaffen.
Hallo, ihr zwei!
Einen schönen Artikel habt ihr da geschrieben und es macht trotz aller Länge Freude, sich die unterschiedlichen und auch nicht so unterschiedlichen Meinugen zu Roll Inclusive durchzulesen.
Mir kamen beim Lesen zwei Fragen auf, die ich gerne stellen würde. Sie gehen beide an Markus:
Du schreibst: „Inhaltlich ist das entscheidend, da zwar auch die Archäologie interpretiert, in ihrer Quelle, dem Boden, jedoch das arbiträre Moment der Autor*innen und somit eine wichtige Fehlerquelle fehlt.“
Da verstehe ich nicht ganz wie du das meinst, weil ich vermutlich nicht weiß, was du mit dem arbiträren Moment meinst. Inwieweit hebt sich „der Boden“ von einer anderen historischen Quelle ab und inwiefern ist da weniger „arbiträres“ drin als bei der Auslegung von z.B. einer päpstlichen Bulle?
Auch „Gut, wenn diese Nanogames eine erzieherische Maßnahme sein sollen, dann ist für Spaß kein Platz.“ verstehe ich nicht ganz, weil Erziehung und Spaß sich ja nicht ausschließen müssen. Der abschließenden Einschätzung des Absatzes, dass wenn die Frage „Warum mache ich das hier eigentlich?“ aufkommt wenig gewonnen ist schließe ich mich aber an.
Danke!
Hallo Denkfred!
vielen Dank für deinwn Kommentar. Da warst du ja flott und intensiv durch mit Lesen!
Zu deinen Fragen:
Bei den üblichen historischen (Schrift)quellen gibt es zwei Stellen, an denen Verfälschung stattfinden kann. Die eine ist die Interpretation durch Historiker*innen. Das gilt analog in der Archäologie.
Die andere Stelle ist aber bereits die Erzeugung der Quelle: Schreiber*innen, bzw. ihre Auftraggebenden entscheiden meist bewusst und mit klarer Zielsetzung, was sie wie aufschreiben. Das trifft insbesondere bei einer päpstlichen Bulle zu, aber auch bei Berichten von Tacitus o.ä. Neutral und objektiv sind sie alle nicht.
Das gilt bei archäologischen Quellen weniger: nur selten wird ausgewählt, was wie in den Boden kommt. Man dachte meist nicht, dass irgendjemand den Kram wieder azsgräbt. Insofern fehlen hier die potenziell verfälschende Wirkung von bewusster Entscheidung und Zielsetzung. Das macht diese Quellen deutlich neutraler.
Zu Frage 2: Erziehung ohne Spaß ist sicher ein veralteter Ansatz, der heute nur noch unter bestimmten Bedingungen herangezogen wird. Manchmal muss Erziehung aber auch ernst und konsequent sein. Dementsprechend könnte ich hier den mangelnden Spaßfaktor einzelner Nanogames erklären. Spielen will ich sie trotzdem nicht. – Bis auf meine zwei Favoriten natürlich : )